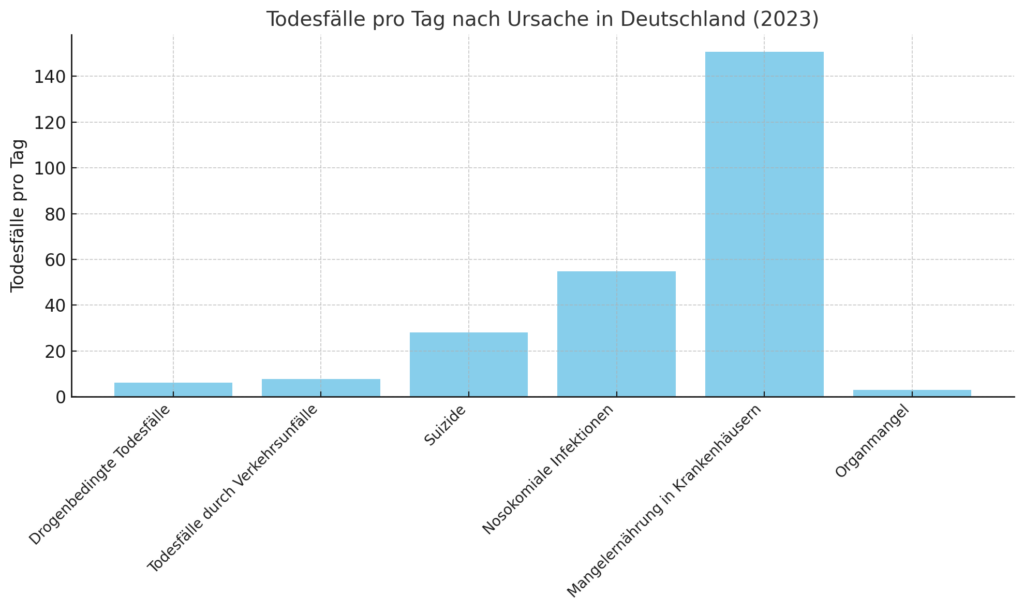Wie die New York Post erst am 18. Oktober 2024 berichtete, ereignete sich im Oktober 2021 im Baptist Health Richmond Hospital in Kentucky ein schockierender Vorfall: Der 36-jährige Anthony Thomas „TJ“ Hoover wurde nach einer Überdosis Drogen ins Krankenhaus eingeliefert und dort für hirntot erklärt. Während der Vorbereitung zur Organentnahme zeigte er jedoch plötzlich deutliche Lebenszeichen.
Natasha Miller, eine Organpräparatorin, war an diesem Tag im Operationssaal anwesend. Sie berichtete, dass Hoover beim Hereinrollen in den Raum Anzeichen von Leben zeigte: „Er bewegte sich – er schlug um sich. Und als wir dann hinübergingen, konnte man sehen, dass ihm die Tränen kamen. Er weinte sichtlich.“
Diese unerwarteten Reaktionen führten dazu, dass zwei der anwesenden Ärzte ihre Teilnahme an der Operation verweigerten. Dennoch versuchte die Fallkoordinatorin der Kentucky Organ Donor Affiliates (KODA), andere Ärzte zu finden, um den Eingriff fortzusetzen. Miller erinnerte sich: „Die Koordinatorin rief also die damalige Vorgesetzte an. Und sie sagte, er habe ihr gesagt, sie müsse ‚einen anderen Arzt dafür finden‘ – ‚wir würden diesen Fall übernehmen. Sie muss jemand anderen finden‘.“
Nyckoletta Martin, eine weitere KODA-Mitarbeiterin, entdeckte bei der Untersuchung von Hoovers Fall, dass er während einer Herzkatheteruntersuchung am selben Morgen aufgewacht war und sich auf dem Tisch gewälzt hatte. Trotz dieser Anzeichen von Bewusstsein wurde Hoover lediglich sediert, und die Vorbereitungen zur Organentnahme wurden fortgesetzt.
Dieser Vorfall führte zum Rücktritt mehrerer KODA-Teammitglieder. Martin äußerte ihre Besorgnis: „Ich habe mein ganzes Leben der Organspende und -transplantation gewidmet. Es macht mir große Angst, dass diese Dinge nun passieren dürfen und es keine besseren Maßnahmen zum Schutz der Spender gibt.“
Hoover überlebte den Vorfall und lebt nun bei seiner Schwester, Donna Rhorer, die als seine gesetzliche Vormundin fungiert. Obwohl er sich in vielerlei Hinsicht erholt hat, kämpft er weiterhin mit Gedächtnisproblemen sowie Schwierigkeiten beim Gehen und Sprechen.
Vertreter von KODA bestritten, dass ein Mitglied ihrer Organisation Ärzte angewiesen hätte, an einem lebenden Patienten eine Organentnahme durchzuführen. Sowohl der Generalstaatsanwalt von Kentucky als auch die US-amerikanische Gesundheitsbehörde Health Resources and Services Administration untersuchen derzeit den Vorfall.
Quellen: New York Post, The Guardian, t-online
Kommentar:
Dieser Fall wirft erneut ernsthafte Fragen zur Zuverlässigkeit der Hirntod-Diagnose und zu den ethischen Praktiken bei der Organentnahme auf.
Es gibt keine wissenschaftlichen Studien, die belegen könnten, dass sterbende Menschen im Zustand des Hirnversagens (Hirntod) nichts mehr empfinden. Es ist eine Hypothese, eine Annahme, die die Transplantationsmediziner aufgestellt haben. Auch dieser Fall von Anthony Thomas Hoover zeigt, dass deutliche Zeichen des Lebens, bei einem „definierten Hirntod“ eben als Reflexe abgetan werden.
Auf meine Kritik an der Auffassung, dass Hirntote Tote sind und nicht, wie ich es, bei meiner Frau erlebt habe, eine Sterbende, wird immer wieder stereotypisch geantwortet: Wachkomapatienten sind keine Hirntote! – Ich glaube behaupten zu dürfen, dass ich nach über dreißig Jahren, in denen ich mich für Hirnverletzte und vielen Wachkomapatienten eingebracht habe, den Unterschied sehr wohl kenne. Doch es scheint, so auch der Fall Hoover, dass diese Unterscheidung den Transplantationsmedizinern bis heute nicht klar ist, bzw. die Verantwortlichen in Medizin und Politik nicht eingestehen wollen. Wie nah ein Wachkomapatient dem „Hirntod“ ist, zeigt doch dieser Fall wieder einmal ganz deutlich.
Ein „Hirntoter“ ist keine Leiche, kein Toter im gesellschaftlichen Sinn. Er ist ein Sterbender, der normalerweise nicht mehr ins bewusste Leben zurückkehren kann – es sei denn, er heißt Anthony Thomas Hoover.